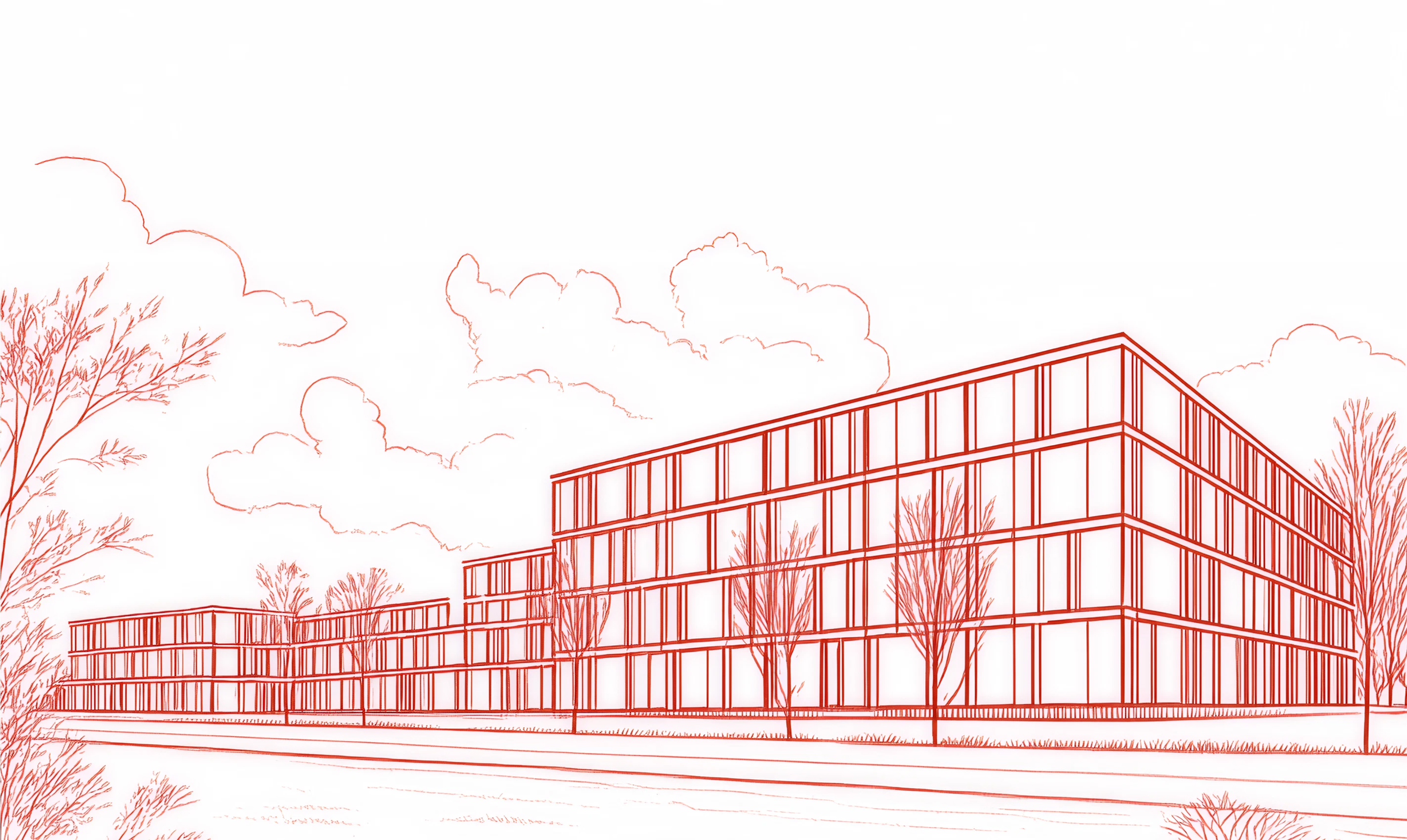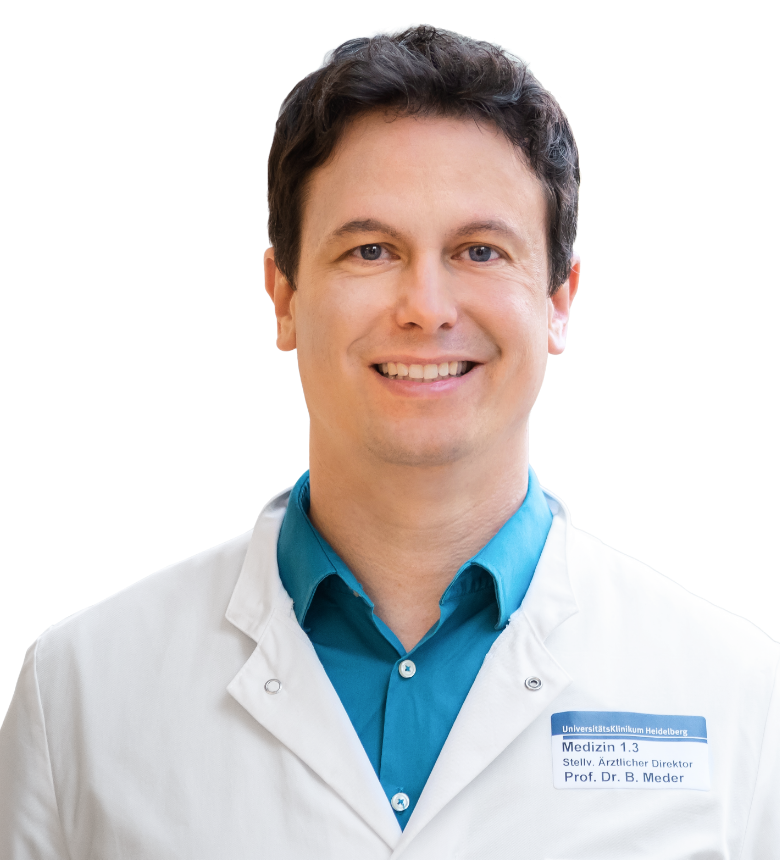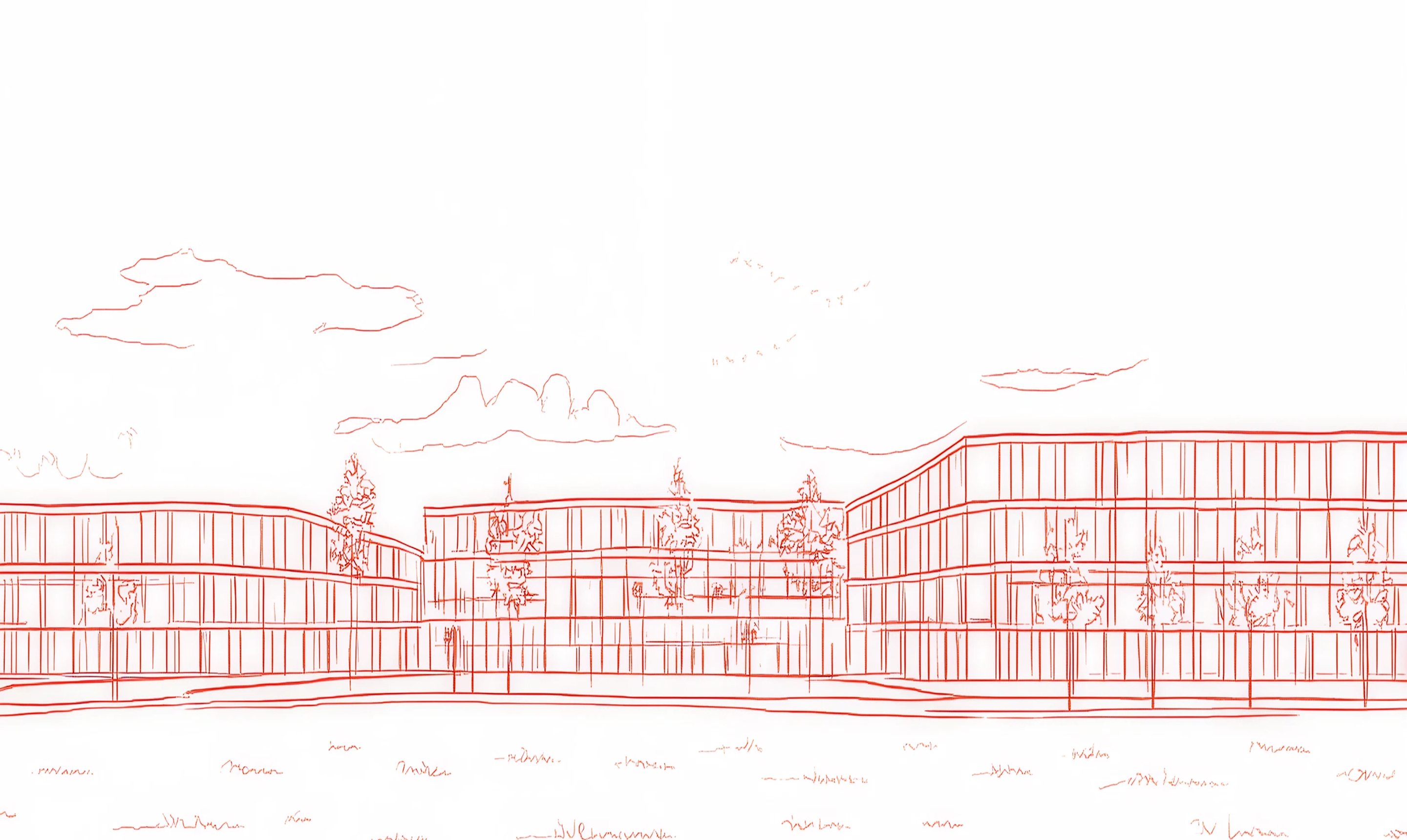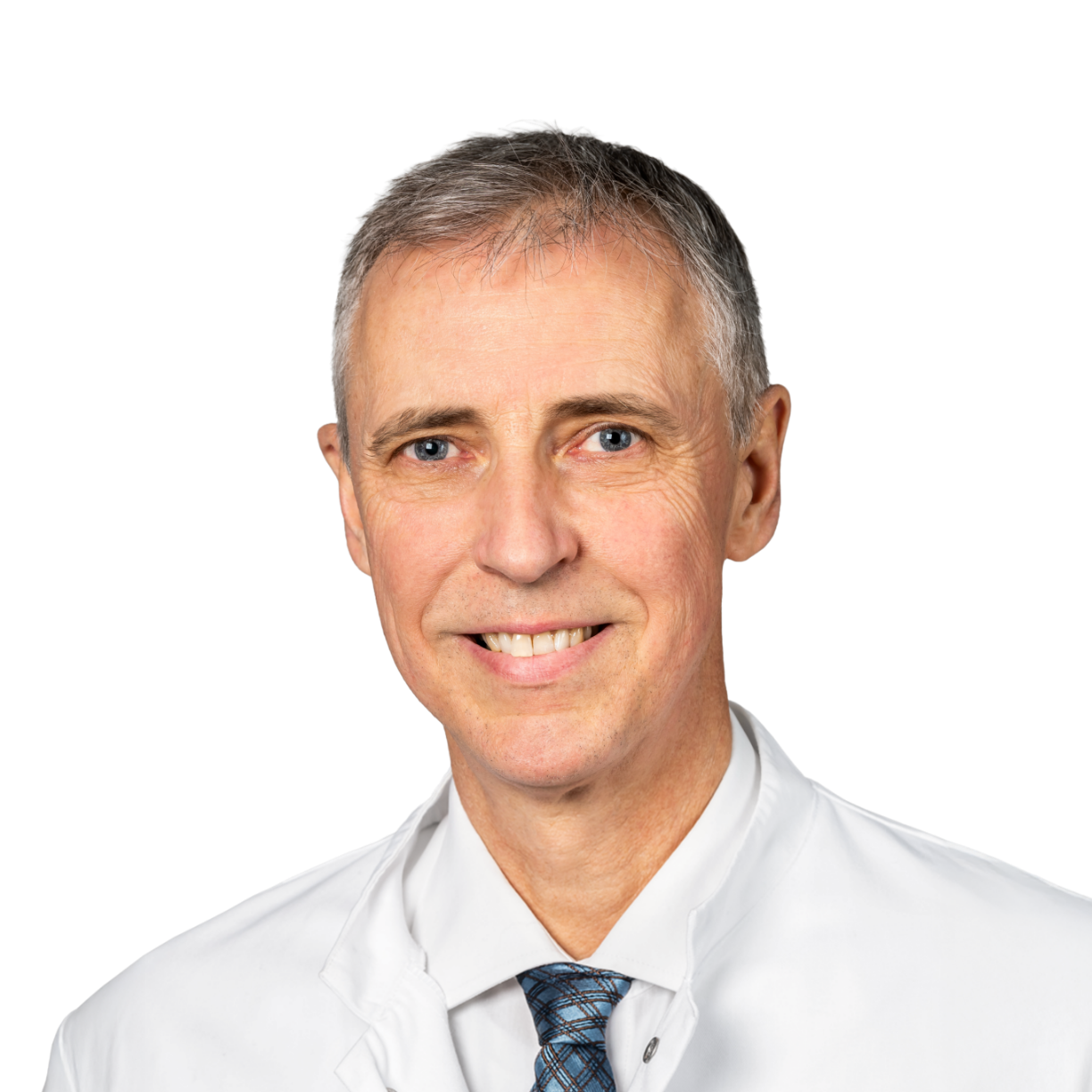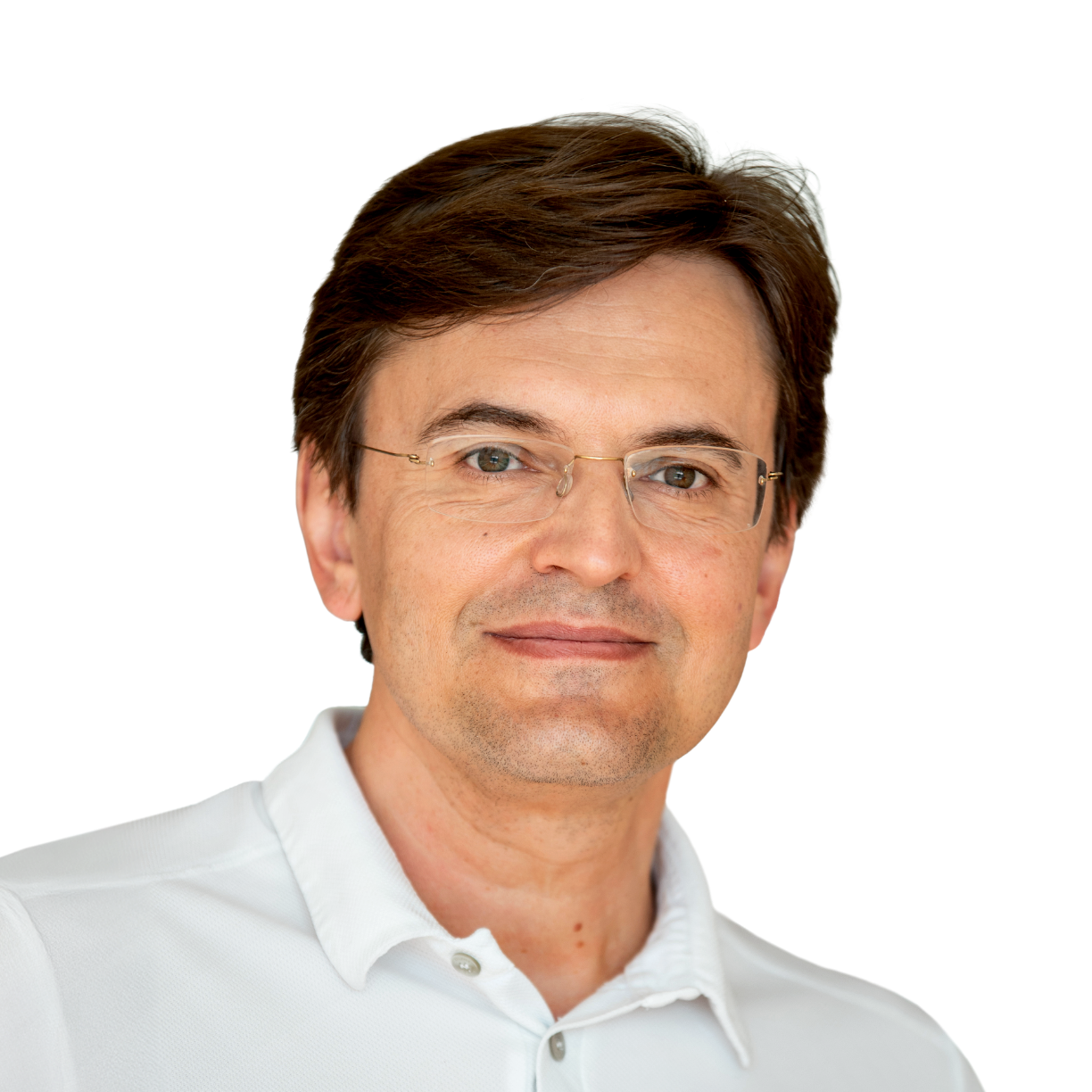Gemeinsam für Menschen mit schwerer Herzschwäche – Pflege mit Blick fürs Ganze
Jana Wagner: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PflegeKraft HD, dem Pflege-Podcast des Universitätsklinikums Heidelberg. Diese Folge ist Teil unserer kleinen Serie rund um die Pflege von Herzpatientinnen und -patienten. Heute geht es um echte Teamarbeit, und zwar zwischen zwei Bereichen, die bei Menschen mit schwerer Herzschwäche besonders eng zusammenarbeiten: der Herzchirurgie und der Inneren Medizin.
Ich bin Jana Wagner und arbeite in der Unternehmenskommunikation am UKHD und freue mich heute auf Yvonne Müller. Sie ist VAD-Koordinatorin, also Ventrikel Assist Device- Koordinatorin, in der Chirurgie und Lena Jung. Sie ist Pflege APN in der Medizinischen Klinik. Hallo ihr beiden!
Yvonne Müller: Hallo!
Lena Jung: Hallo Jana.
Jana Wagner: Beide begleiten ihre Patientinnen auf dem Weg zur Transplantation durch große Operationen hindurch und oft über viele Monate oder sogar Jahre hinweg. Wir sprechen darüber, wie Pflege in solchen Ausnahmesituationen Halt geben kann, wie gute Zusammenarbeit über Klinikgrenzen hinweg gelingt und was sie sich vom neuen Herzzentrum für ihre tägliche Arbeit erhoffen.
Ich würde euch gerne einfach mal ganz kurz vorstellen bei den Zuhörern. Wir fangen mal bei dir an, Lena. Du bist ja eine Pflegeexpertin APN in der Medizinischen Klinik. Was bedeutet das genau und was machst du denn beruflich?
Lena Jung: Also, ich habe mich auf kardiologische Patienten spezialisiert. Und da vor allem auf die Herzinsuffizienz-Patienten, also Patienten, die eine Herzschwäche haben. Das heißt, der Herzmuskel pumpt einfach nicht mehr ausreichend. Diese Patienten kommen dann bei uns auf Station an, sind konfrontiert mit einer chronischen Erkrankung, die sich immer weiter verschlechtern wird. Und da komm ich ins Spiel. Ich versuche, die Patienten über die Erkrankung aufzuklären, mit ihnen über Symptome oder auch Nebenwirkungen zu sprechen, sodass die Patienten selbstbestimmt und zügig Verschlechterungen erkennen können, aktiv eingreifen können und schauen, was tut mir im Alltag gut, also ihr Leben so aktiv wie möglich mit der höchst möglichsten Lebensqualität weiterhin gestalten zu können.
Jana Wagner: Und der Weg des Patienten geht dann von der Reihenfolge weiter an Yvonne ist das richtig?
Lena Jung: Ja genau, weil die Medizin hat sich super viel weiterentwickelt: Wir können wirklich viel medikamentös machen, aber irgendwann ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass wir zu drastischeren Möglichkeiten greifen müssen. Und da ist es unglaublich genial, dass es inzwischen die Möglichkeit der Assist Devices gibt, weil wir einfach ganz, ganz wenig Organe haben und ganz viele Menschen sehr lange warten, aber diese Wartezeit natürlich Schäden an den anderen Organen verursacht und einfach manchmal auch zu lange dauern würde.
Jana Wagner: Und Yvonne, du bist VAD-Koordinatorin, also Ventrikel Assist Devices, in der Chirurgie, was machst du denn genau?
Yvonne Müller: Das ist eine sehr gute Frage, die bekomme ich auch häufig gestellt oder unser Team. Also wir sind drei Menschen, die sich um Menschen kümmern mit Terminaler Herzinsuffizienz, die am Rande ihrer Herzinsuffizienz Karriere sind, wie Lena schon gesagt hat. Die Zeit läuft einem manchmal weg, trotz optimaler Betreuung und Herzen wachsen leider nicht hier bei uns im Hinterhof auf einem Baum. Und um diese Wartezeit besser zu gestalten, dass sie am Ende nicht so schlecht sind, dass sie gar nicht mehr für eine Transplantation in Frage kommen, gibt es mechanische Unterstützungssysteme, die entweder links oder rechts und in manchen Fällen leider auch bi-ventrikulär eingebaut werden, die dann die Kreislauffunktion übernehmen, um so die Durchblutung zu generieren und das bestmögliche Outcome bis zur Transplantation zu gewährleisten. Vor zehn, fünfzehn Jahren waren das Menschen, die von der Intensivstation weg implantiert wurden. Die waren „crashed and burned” nennt man die. Die haben danach auch in der Klinik gelebt, bis sie transplantiert wurden oder es hatte leider ein tragisches Ende und es kam gar nicht so weit. Und in den letzten Jahren, unter anderem durch die Betreuung von eben speziellen Teams, haben wir es geschafft, dass diese Leute nach Hause gehen können, dass sie arbeiten können teilweise, dass sie wieder ein normales, relativ normales Lebensgefühl und auch Familien-Gefühl haben. Wir betreuen nicht nur Leute, die 60 aufwärts sind. Die klassische chronische Herzinsuffizienz ist ab 50 aufwärts, sondern wir haben auch einen „Kindergarten” und damit sind nicht Kinderklinik-Patienten gemeint, sondern wirklich Menschen zwischen 20 und 40, die eigentlich mitten im Leben stehen. Und der VAD-Koordinator in Heidelberg ist sozusagen schon vor der Implantation tätig, indem er den Menschen erstmal erklärt, was ist das für ein Teil, was die da in mich rein implantieren wollen. Wie ist das Leben danach, wie kann ich mich verhalten? Wir sind teilweise bei der OP, bei der Implantation dabei, und wir schulen danach. Ab Intensivstation, sobald sie sprechen können, fangen wir an: Wie kommt da der Strom dran? Was muss ich beachten? In kleinen Abschnitten, so wie es jeder braucht, begleiten sie bis in die Reha und dann hört aber unser Job nicht auf, sondern wir gestalten mit den Kardiologen zusammen eine interdisziplinäre Nachsorgeambulanz und sehen die praktisch gemeinschaftlich. Meine Kollegen und ich von chirurgischer Seite und die Kardiologen unterstützen uns dabei, so dass wir sie dann bestmöglichst Richtung Transplantation vorbereiten.
Jana Wagner: Lena, wenn du an die Menschen denkst, die ihr gemeinsam betreut, was sind das für Patientinnen, wie erlebst du sie in dieser besonderen Phase ihres Lebens?
Lena Jung: Also, die Patienten und Patientinnen kommen ja häufig bei uns auf Station und für sie ist die Diagnose ganz plötzlich: Sie waren eigentlich ein bisschen erkältet, oder haben Sie sich ein bisschen schlapp gefühlt und jetzt auf einmal konfrontieren wir sie mit der Diagnose, dass Sie Herzkrank sein sollen. Das sind dann wirklich Patienten, die zum Beispiel notfallmäßig aus dem Urlaub zurückgeflogen werden, weil sie auf einmal Luftnot haben. Die rechnen mit einem akuten Ereignis, die rechnen nicht damit, dass sie chronisch krank sind. Die rechnen damit, sie kommen zu uns und sie gehen als gesunde Patienten wieder nachhause und das ist ein ganz schwieriger langer Prozess und zu diesem Zeitpunkt fühlen sie sich auch noch geschwächt und schlecht und überfordert und da versuchen wir einfach da zu sein, Optionen aufzuzeigen und einfach zu unterstützen.
Yvonne Müller: Die Herzerkrankung ist doch so ein ganz zentrales Thema. Das Herz ist ja auch emotional besetzt, da spielen so viele Faktoren mit rein und auch Existenzängste, wenn man mit einer chronischen Erkrankung überfallen wird, die man so bisher gar nicht gefühlt oder erlebt hat. Also das, was Lena sagt: Ich geh ins Krankenhaus und dann bekomme ich halt ein paar Medikamente und dann gehe ich nach Hause und dann ist wieder alles gut. Dann komme ich zurück zu meinem alten Leben. Und diesen Sprung, es geht nicht zurück ins alte Leben, wir können helfen, Dinge zu verlangsamen im Rahmen der chronischen Erkrankungen, aber wir können sie nicht heilen primär, das ist glaub ich so ein Knackpunkt, an dem jeder erstmal zu knabbern hat.
Jana Wagner: Kannst du uns vielleicht schildern, was diese Menschen brauchen, also sowohl medizinisch als auch emotional und welche Rolle ihr als Pflegekräfte dabei spielt?
Yvonne Müller: Ist ganz multifaktoriell tatsächlich und immer individuell. Natürlich brauchen die eine engmaschige medizinische, hochprofessionelle Betreuung in Form von Diagnostik und Therapie, aber bei all dieser Professionalität und der medikamentösen Therapie brauchen sie vor allem emotionale Unterstützung: Die sind aufgewühlt, die sind verunsichert, haben Ängste und müssen aber trotzdem relativ schnell durchgeschleust werden und auch wieder nach Hause geschickt werden auf eigene Füße. Sie müssen ganz viele Dinge auf einmal lernen, auf sich zu achten: Jeder weiß, dass Diabetes nicht gut ist, dass Bluthochdruck nicht gut ist. Gesunder Lebensstil. Aber das ändert man nicht von heute auf morgen. Und jetzt habe ich die Diagnose und dann kommt jemand und sagt mir: ja, Sie müssen abnehmen, Sie müssen Sport machen, Sie müssen dies machen. Aber mit meiner Herzerkrankung kann ich das vielleicht gar nicht und ich werde ganz viel bevormundet und bekomme ganz viele Regeln, muss Tabletten nehmen, vielleicht acht, zehn Stück zum Frühstück. Da hab ich schon gar keinen Hunger. Ja, und da die Adhärenz zu generieren, mit dem Patienten zusammen einen Therapieplan aufzustellen, mit ihnen zusammen den Weg zu gehen, sie dort – es klingt immer so lapidar – sie abzuholen, wo sie stehen, aber genau das ist es: Man muss für jeden Patienten den Punkt finden, wo man einhaken kann, wo man das Vertrauen bilden kann und dort dann weiter arbeiten. Das heißt, wir müssen unsere Konzepte ständig umstellen. Wir können da nicht nullachtfünfzehn Pläne erstellen, damit wir sie wirklich ganzheitlich richtig betreuen können.
Jana Wagner: Was ich raus höre, ihr bekleidet eure Patient:innen ja auch über eine sehr lange Zeit und was bedeutet denn diese Kontinuität für die Menschen und auch für euch?
Yvonne Müller: Langzeitbetreuung von solchen Patienten ist wie eine Beziehung. Es gibt gute Zeiten. Es gibt schlechte Zeiten. Es gibt ein bisschen Drama und dann gibt es wieder Versöhnungszeiten. Am Ende sind wir sehr nah an den Menschen dran, wir wissen auch viel von der Familie, wie es zuhause ist und das hilft uns aber auch dabei einzuschätzen: Wie können wir weiterarbeiten? Wenn meine Patienten in die Ambulanz kommen, sehe ich denen meistens schon von Ferne an: irgendwas stimmt nicht. Und wenn man nur Standard-Fragen stellt, kommt man nicht dahinter, aber da man sich so gut kennt, kann man an den kleinen Nuancen schon sehen, da ist irgendwas im Busch und das hilft uns total, dass wir einfach sehr eng sind. Aber wenn man sehr eng ist, muss man sich auch abgrenzen können. Manchmal sind wir die kleine Hausarztpraxis und werden auch wegen nicht kardiologischen Dingen angerufen: wegen des Nachbarn, der sich am Arm verletzt hat, oder weil das Kind geimpft werden muss.
Jana Wagner: Mich würde dabei interessieren: es gibt da ja ein vor und nach Transplantation – gibt es da auch eine Veränderung in der Beziehung und wenn ja, wie zeigt sie sich?
Yvonne Müller: Für uns als VD Koordinatoren Team definitiv, denn mit der Transplantation ist unsere Betreuung abgeschlossen. Und das stürzt die Menschen erst – manche zumindest – in einen ganz großen Konflikt. Das ist das Team, mit dem ich ganz lange gearbeitet habe. Zu denen habe ich Vertrauen, jetzt sind da andere Menschen. Mag ich die? Kenn ich die? Lena und ihr Team auf „Wunderlich“ kennen sie, aber sie werden durch andere Ambulanzen durchgeschleust. Die Betreuung ist nicht mehr ganz so intensiv wie am Anfang und das ist ein Abnabeln. Und dieser Absprung fällt manchen schwer. Wir freuen uns aber immer, wenn sie uns danach besuchen kommen. Und es gibt einige, die kommen vorbei und sagen: ich wollt mal „Hallo” sagen.
Jana Wagner: Was würdest du denn sagen, Lena, was hilft den Patient:innen, Vertrauen zu fassen? Was könnt ihr tun, damit sie sich dann auch sicherer fühlen? Bei der ganzen Prozedur?
Lena Jung: Also ich glaube, vor allem kennen die Patienten uns am Bett und als Team auf Station im Alltag. Wir sind immer wieder da. Bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist es einfach so, dass sie häufig rotieren, das heißt, die Patienten haben keinen festen Ansprechpartner, aber gerade Yvonne und ihre Kolleginnen und Kollegen, die sind immer dieselben in der Ambulanz. Wir sind immer auf Station, das ist immer ein ähnliches Team. Die kennen schon genau die Personen, zu denen sie vertrauen haben und dann ist natürlich gerade bei wiederholten Aufenthalten die Hemmschwelle viel, viel niedriger. Also wir sind sehr niedrigschwellige Ansprechpartner, wir klären noch mal Fragen auf, wir sind viel häufiger erreichbar als jetzt zum Beispiel unser Oberarzt, der ganz tolle ausführliche Visiten macht, aber halt dann wieder weg ist. Und natürlich sind bei uns auch die Fragen viel alltagsnaher: also wie mache ich das zuhause? Oder wir fragen: Wie machen sie das denn zuhause? Und erst dann wird den Patienten klar: ich gehe ja, irgendwann nach Hause. Ich muss es ja dann irgendwie selber machen. Wie mach ich das denn dann eigentlich? Und ich glaube, wir haben auch gelernt, dass wir uns, so wie Yvonne auch schon gesagt hat, sehr auf die Kompetenzen des Patienten einlassen können. Also, natürlich würden wir uns wünschen, dass die Patienten das verstehen und perfekt umsetzen und ihren Lebensstil ändern und sowieso absolut perfekt sind. Aber natürlich wissen wir, dass das ein Wunsch ist, der bei uns selber ja auch nicht in Erfüllung geht, und wir versuchen genau in dem Rahmen, in dem der Patient oder die Patientin das leisten kann, dann auch unsere Beratungsangebote oder unsere Anforderungen an den Patienten zu stellen. Das heißt, ich glaube, Sie haben wenig Angst auch vor uns. Sie wissen, Sie können ehrlich auch sagen, wenn mal Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und wir versuchen das dann aber auch einfach noch mal darzustellen, dass es kein Scheitern ist, wenn mal etwas nicht gut klappt.
Jana Wagner: Wir reden gerade über ein enges Zusammenspiel von Chirurgie und der Innerer Medizin. Ihr habt ja genau bei diesem Thema eine sehr große Teamarbeit und arbeitet in zwei unterschiedlichen Bereichen, eben also Chirurgie und Innere Medizin, wie gesagt, aber mit denselben Menschen. Deswegen möchte ich gerne wissen – wir fangen gerne mit dir an Yvonne –wie funktioniert denn die Zusammenarbeit aus deiner Sicht in der Praxis?
Yvonne Müller: Immer besser, muss ich tatsächlich sagen. Mein Kollege, der Florian Müller, der vor Jahren hier mit der VAD-Koordination angefangen hat, das war der Pionier. Der hat die Internisten und die Kardiochirurgen sehr eng zueinander geholt. Früher waren wir auch noch viel räumlicher getrennt, also die alte Chirurgie war ja mehrere 100 Meter entfernt und der Botanische Garten war zwischendrin. Das war eine ganz klare Grenze und inzwischen ist das so: Wir sind ein verwobenes, interdisziplinäres Team und im Mittelpunkt steht tatsächlich der Patient. Wir sind uns nicht alle einig, das ist wie einer großen Familie: Da wird auch viel diskutiert und jeder weiß es ein bisschen besser, aber am Ende ist das wie ein Puzzleteil, das zusammengeht. Und ich finde, wir profitieren auch voneinander. Also die Kardiologen können dies besser, die Kardiochirurgen können das besser und wir stehen dann so ein bisschen in der Mitte und versuchen, uns aus jedem Päckchen das Optimale dann rauszuholen und auch manchmal einfach zu vermitteln zwischen den Mitspielern sozusagen.
Jana Wagner: Und Lena, was braucht es für dich, damit es gut klappt?
Lena Jung: Also ich glaube auch, dass dieses räumliche Zusammenkommen einfach genial war. Natürlich können wir auch telefonieren und Emails schreiben, aber es ist total niedrigschwellig, dass wir mal kurz auf dem Flur quatschen oder irgendwie uns absprechen. Ich kann rüber laufen und noch mal fragen, wie macht ihr das? Frisch nach OP, sieht die Wunde wirklich gut aus? Also es ist einfach viel vernetzter und ich glaube dass Austausch einfach wahnsinnig wichtig ist und bin ganz glücklich dass wir da, wie eine große Familie zwar sind, aber auch einfach alle Fragen erlaubt sind und wir offen darüber reden können.
Jana Wagner: Wir haben jetzt über den Austausch und die Kommunikation gesprochen. Was macht denn für euch eine gute Zusammenarbeit in der Pflege aus, also gerade bei so komplexen Fällen, gibt es da bestimmte Parameter, die euch einfallen?
Lena Jung: Ich glaube, unser großes gemeinsames Ziel ist es, die Patienten ganzheitlich zu betreuen, sie in ihrer Individualität zu sehen und auch zu schauen, wie ist ihr häusliches Umfeld? Wie sind denn die familiären Bedingungen, wie kommen sie klar? Und da sind wir uns sehr einig. Dann wird natürlich auch die Zusammenarbeit sehr viel einfacher, weil wir ähnliche Visionen und Ziele haben und da gut miteinander harmonieren können. Und einfach ein kurzer Satz reicht: wir müssen da noch mal – keine Ahnung – in die berufliche Situation vom Patienten gucken und dann können wir uns gut ergänzen. Diese gemeinsame Definition von Pflege eben den Patienten wirklich in all seinen Facetten zu begleiten und irgendwie auch zu unterstützen, wie er gut im Alltag zurechtkommt mit seiner wirklich sehr einschränkenden chronischen Erkrankung, das hilft uns im Miteinander sehr.
Yvonne Müller: Der persönliche Austausch, den wir haben, dadurch, dass wir uns auch häufiger sehen: Dadurch kann man häufiger Kleinigkeiten ansprechen. Wenn man so feste Termine hat und in die andere Klinik geht: Jetzt machen wir die Besprechung über den und den Menschen. Dann gehen Nuancen verloren und durch diesen täglichen Austausch und durch diese kurzen Interaktionsketten – es sind nicht immer unbedingt Parameter, natürlich haben wir Parameter, man misst NT-proBNP, man misst verschiedene Laborparameter, man schaut natürlich nach dem Echo und nach der Leistungsfähigkeit, aber das sind erstmal nur Werte und wir behandeln ja keine Werte. Sie sind wichtig für die Entscheidung, aber am Ende: die Kleinigkeiten, mit der eine Therapie steht und fällt, sind eben Adhärenz: Nimmt jemand seine Medikamente, ist jemand im häuslichen Umfeld gut betreut oder geht er uns zu Hause unter? Es gibt Menschen, die in der Klinik super stabil sind, nachdem sie dekompensiert kamen und rekompensiert wurden. Die gehen nach Hause und kommen nach sechs Wochen wieder, weil sie es zuhause nicht hinbekommen. Jetzt kann man die alle sechs Wochen oder alle acht Wochen aufnehmen und man kann sagen, ja wir rekompensieren und schicken sie halt wieder nach Hause, das spielt man dann ewig lange. Oder man tauscht sich aus: Habt ihr eine Idee, woran könnte es liegen, kannst du noch mal eine Beratung anbieten, eine Nachschulung? Hast du mal mit dem Hausarzt telefoniert oder so etwas? Kennst du die Familie? Ich hab den Sohn lange nicht gesehen. Solche kleinen Nuancen bekommt man in diesem persönlichen Austausch viel schneller raus. Und keine Visite hat dafür Zeit, wenn man ganz ehrlich ist. Eine Visite ist für medizinische Parameter und für Labor und für Diagnostik, aber für solche psychologischen Momente fehlt dann einfach die Zeit in unserem Hochleistungsbetrieb. Und das können wir als Team Wunderlich und VAD-Koordinatoren ganz gut ausgleichen, um da den richtigen Ton zu treffen. Jeder von uns kann singen, aber zusammen sind wir dann halt ein Chor mit dem Patienten, vielleicht kann man es so sagen.
Jana Wagner: Das klingt nach einer tollen Zusammenarbeit. Vielen Dank für die anschauliche Schilderung. Ich wag jetzt mal einen Blick in die Zukunft: Ich habe ja vorhin schon von dem neuen Herzzentrum gesprochen und würde gerne wissen – Yvonne am besten noch ¬– im neuen Herzzentrum werdet ihr ja zukünftig noch näher beieinander sein. Was bedeutet das denn für eure Arbeit?
Yvonne Müller: Für uns als VAD-Koordinatoren: Wir haben weniger Schritte pro Tag, weil wir nicht mehr durch alle Kliniken laufen. Prinzipiell finde ich es ein super Game Changer, weil wir noch näher… wir sind dann eine WG. Es ist nicht ein Reihenhaus und ich muss raus und geh rüber, sondern wir sind direkt dran. Die Informationen sind noch schneller und ich glaube, die Patienten fühlen sich nicht „Ah, jetzt bin ich in der inneren Medizin, dann werde ich in die Chirurgie verlegt, dann werde ich wieder in die innere Medizin verlegt”, sondern es ist ein Herz-Team und ein Herzzentrum. Das ist offensichtlicher auch für die Menschen, dass sie nicht… sie werden ohnehin nicht durchgereicht… aber, dass sie sich dann noch mehr aufgehoben fühlen und für uns sind die Dienstwege noch viel, viel kürzer sich auszutauschen.
Jana Wagner: Jetzt war es ja auch mit der neuen Chirurgie schon eine Nähe, die geschaffen wurde. Das habt ihr sogar auch schon gesagt und dann wird es ja noch näher. Lena, wie siehst du das, was wünscht du dir denn für die Pflege im neuen Herzzentrum fachlich, aber auch für das Miteinander?
Lena Jung: Ich freu mich total. Ich freu mich wirklich noch mal einfach ganz unkompliziert chirurgische Herausforderungen nachzufragen. Auch noch mal Dinge wirklich zu verstehen. Jetzt, wenn wir wirklich chirurgische Frage haben, rufen wir an. Dann hab ich Kollegin XY am Telefon, ich habe keine kein Bild von ihr. Aber trotzdem bekomme ich meine Frage beantwortet. Aber ich freue mich auch wirklich, mit den Patienten zu arbeiten. Und jetzt als Beispiel die herztransplantierten Patientinnen und Patienten rausgenommen - Yvonne hat es ja vorhin schon erwähnt -, die haben meistens schon eine VAD-Vorgeschichte, aber auf jeden Fall haben sie eine lange Krankheitsgeschichte, in der sie engmaschig betreut wurden. Und dann bekommen Sie ein neues Herz. Ein Ziel, auf das sie sehr lange gewartet haben und dann sind sie völlig überfordert und es werden Dinge zu Problemen, von denen wir überhaupt nie gedacht haben, dass Sie zu Problemen werden. Häufig kriegen wir zurückgemeldet: „Ich weiß jetzt gar nicht mehr, also in der Chirurgie war das so und so und ich jetzt ist es anders und was ist jetzt richtig und was mach ich jetzt? Wenn ich zu Hause bin?” Und die sind völlig überfordert. Und da freue ich mich wahnsinnig, dass wir dann eine Einheit sind. Wir sprechen mit einer Sprache, das beruhigt die Patienten, die haben eine einheitliche Aussage. Genau. Wir haben gleiche SOPs, wir haben alles ist wirklich vereinheitlicht und die Patienten können sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und verlieren sich nicht in solchen Unterschieden.
Jana Wagner: Ich hätte zum Abschluss noch eine persönliche Frage vielleicht an euch oder vielleicht könnt ihr an unsere Zuhörer auch ein paar Tipps geben. Eure Rollen sind ja schon sehr besonders, ihr habt viel Verantwortung, ihr habt sehr viel Spezialwissen, wie seid ihr denn aber bis dahin gekommen und was sollte vielleicht jemand mitbringen, der auch einen ähnlichen Weg gehen möchte?
Yvonne Müller: Wie wird man VAD-Koordinator? Das ist eine gute Frage, weil der Beruf des VAD-Koordinators ist rechtlich und staatlich überhaupt nicht geschützt. Es gibt keine Ausbildung dafür. Das heißt, wir sind klassisch Gesundheits- und Krankenpfleger. Haben, wir haben alle auf Intensiv gearbeitet und haben uns dann über Fortbildungen außerhalb des medizinischen Bereichs nachqualifiziert. Wir werden von Firmen geschult, wir sind Wund-Experten. Die Lisa bei uns hat einen Kardio-Psychokurs gemacht. Man sucht sich so aus vielen Töpfchen aus, was zu diesem Konstrukt passt. Und tatsächlich ist VAD-Koordinator im Uniklinikum recht ganzheitlich. Das heißt, wir sind schon vor der OP, wir klären auf, wir selektieren und screenen mit den Ärzten zusammen. Wir können bei der OP dabei sein, wir machen die Schulung und wir machen die Ambulanz, also ein sehr großes Spektrum, sind aber auch gleichzeitig mit den Firmen in Kontakt. Wir machen ein bisschen Controlling, wir arbeiten mit der Pharmakologie und Mikrobiologie. Also du siehst: es ist so wirklich, ganz, ganz multifaktoriell. Am Ende musst du mitbringen: Teamgeist. Teamgeist ist ganz wichtig. Du brauchst eine Neugier mit anderen Menschen zu kommunizieren, anderen Berufsgruppen. Aber auch viele… das ganze Spektrum an Patienten, nicht jeder ist gleich. Du musst dich immer wieder neu auf jemanden einlassen und du musst Lust auf Projekte haben, weil wir ganz viele Dinge selbständig regeln. Ich glaube, da kann mir Lena zustimmen: wir stampfen Projekte raus. Wir haben eine App kreiert für unsere Patienten in der Nachsorge. Sowas lernt man nirgendwo, egal welche Ausbildung man hat, sondern man muss einfach Lust auf neue Sachen haben. Und man muss sich abgrenzen können, auch das ist wichtig.
Lena Jung: Als ich nach der Ausbildung auf der Intensivstation angefangen hab, hat man ja vor allem so ein bisschen Respekt und alles ist viel. Und das erste Projekt, das wir da angefangen haben, hat mich einfach gelehrt, dass auch wenn man neu in ein Thema einsteigt, dass da ganz viel positive Resonanz ist. Damals war die Chirurgie wirklich noch viele, viele 100 Meter weit entfernt. Und es ging um die Initialversorgung, also wenn Patienten notfallmäßig zum Beispiel nach Reanimation in die Klinik kommen. Da sind die Fachrichtungen super getrennt, jedes Zentrum hat sein eigenes Notfallmanagement. Und ich hab einfach nachgefragt und ich hab so positive Resonanz bekommen und das glaub ich, hat mich so ein bisschen weitergetragen oder mir auch Ängste genommen, weil ich wusste, ich darf hier einfach fragen und man arbeitet zusammen, auch wenn man ganz unterschiedlich tickt oder vielleicht andere Prioritäten hat. Und so habe ich meinen Bachelorabschluss gemacht und im Endeffekt dann auch noch mal über die Kardio, die ich so liebgewonnen hab, mich entschieden einen Master zu machen, der eben sich konzentriert auf hochkomplexe Patientengruppen, weil genau die brauchen natürlich ein interprofessionelles Team, was sich ganzheitlich kümmert, so wie wir es jetzt versucht haben zu beschreiben. Und sowohl der Master als natürlich auch ganz viele Fortbildungen, die so multifaktoriell sind, weil es einfach so viele Punkte gibt, die da mit reinspielen, haben da ganz arg geholfen. Aber es ist auch so, dass man immer und überall wirklich Unterstützung bekommt, wenn man freundlich fragt. Und dann ist die eigene Entwicklung gekoppelt an die Herausforderungen, die da jeden Tag so auf einen wartet.
Jana Wagner: Ich danke euch beiden vielmals für die Einblicke in eure spannende Arbeit. Ich hoffe, unsere Zuhörer waren genauso gefesselt wie ich von euren Schilderungen. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt das Gefühl habt, ihr habt eine Frage, ihr seid interessiert, nutzt doch mal gerne unsere Kommentarfunktion und stellt eure Fragen, eure Aussagen, eure Bewertungen gerne da rein und wir nehmen uns Zeit, das Ganze zu beantworten. Falls Ihr Interesse an der Pflege-Ausbildung habt oder auch speziell an der Pflege von Herzpatientinnen und Patienten. Dann können vielleicht auch Yvonne und Lena uns das Ganze beantworten. Ihr könnt auch zudem gespannt sein auf die nächsten Folgen unserer kleinen Serie rund um die Pflege von Herzpatientinnen und Patienten. Nächste Folge wird es weitergehen mit dem Thema und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine positive Bewertung da oder empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten vielen Dank Yvonne, vielen Dank Lena für das heutige Interview.